Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
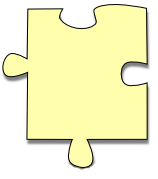
Vom Phänomen des Rassismus ist die Erfahrung des Rassismus zu unterscheiden (Mecheril 2003, S.69). Rassismuserfahrung
wird von Mecheril als psychologische Kategorie bezeichnet, in der gesellschaftlich vermittelte Erfahrungen und der sozial vorstrukturierte Umgang mit diesen Erfahrungen in den Blick geraten. Rassismuserfahrungen nennt Paul Mecheril sozial kontextualisierte, subjektive Zustände und fügt in einer Fußnote an, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also natio-ethno-kulturelle Andere, Erfahrungen der Ausgrenzung, Gewalt und zugeschriebener, möglicher Weise internalisierter Minderwertigkeit in dem gesellschaftlichen Kontext machen, in dem sie aufgewachsen sind. Für die Entwicklung ihrer Selbstkonzepte, ihres Selbstwertgefühles und ihrer sozialen Handlungsbereitschaft ist der Sachverhalt von maßgeblicher Bedeutung, da Rassismuserfahrungen diese Operationalisierungen personaler Identität negativ beeinflussen und von klein auf existent und real sind (Mecheril 2003, S. 69f.).
Gemeint ist jede Erfahrung von Angriff oder Herabwürdigung der eigenen Person oder nahestehenden Personen, in Hinblick auf willkürlich gewählte physiognomische Merkmale (etwa Haarfarbe, Hautfarbe) oder soziale Merkmale (wie Kleidung, Sprache). Dahinter werden Abstammungs- und Herkunftskonstruktionen auf kollektivierende und essentialisierende Weise imaginiert, die Unterscheidungspraxen auf Grund von vermeintlichen charakterlich-moralischen und intellektuellen Differenzen und die daraus resultierende Abwertung legitimieren.
Paul Mecheril beschreibt folgende Dimensionen von Rassismuserfahrungen (Mecheril 2003, S. 70, Paske 2006, S.12):
- Ausprägungsart:
- massiv (z.B. körperliche Gewalt),
- subtil (z.B. abfällige Blicke)
- Vermittlungskontext:
- institutionell (z.B. durch Verwaltungen, Polizei,....),
- individuell (durch Handlungsweisen Einzelner)
- Vermittlungsweise:
- kommunikativ (in sozialen Interaktionssituationen),
- imaginativ (z.B. Träume, Befürchtungen,...),
- medial (z.B. Zeitungen, Radio,...)
- Erfahrungsmodus:
- persönlich (die Person selbst macht Rassismuserfahrungen),
- identifikativ (nahestehende Personen machen Rassismuserfahrungen),
- vikariell (Personen, die als Stellvertreter wahrgenommen werden, machen Rassismuserfahrungen),
- kategorial (die Gruppe, der die Person -vermeintlich oder ihrem Selbstverständnis nach- angehört, macht Rassismuserfahrungen)
