Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
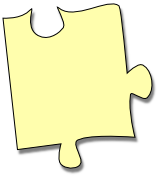
Engombe wird 1972 in Namibia geboren.1Notiz:
für alle folgenden Informationen dieses Abschnitts wurde die gesamte Autobiographie von Engombe (2004) herangezogen.
In den Kriegswirren -Namibia befindet sich zu der Zeit im Krieg gegen Südafrika- muss sie mit ihrer Mutter in ein Lager (Nyango) nach Sambia flüchten. Durch Zufall wird sie auf der Straße von einem weißen Arzt angesprochen und gefragt, ob sie in die DDR fliegen will. Dieses Angebot nimmt sie an.
Der Führer der SWAPO2Notiz:
SWAPO: South West African People's Organisation: diese gründet sich 1960. Vorsitzender ist Sam Nujoma. Die SWAPO setzt sich für die Gründung von Gewerkschaften und die Belange der Arbeiter_innen ein und erhält auf diese Weise großen Zulauf. 1966 beginnt der bewaffnete Kampf der SWAPO gegen Südafrika. Nach dem gewonnenen Befreiungskrieg wird die SWAPO 1989 mit 57% Stimmen als Regierung gewählt. Engombe 2004, S.367f., Sam Nujoma, bittet die DDR mit einer Solidaritätsaktion um Unterstützung. Namibische Kinder sollen in der DDR Unterkunft und Schulbildung erhalten und im Befreiungskampf gegen Südafrika zur SWAPO-Elite herangezogen werden. Die DDR sympathisiert mit der marxistisch-leninistisch orientierten SWAPO und befürwortet den Kampf gegen das imperialistische Feindesland Südafrika. Die Unterdrückung aus dem kolonialen Joch wird somit – wissentlich oder unwissentlich- mit unterstützt.
Im Dezember 1979 kommt Engombe mit 79 weiteren namibischen Kindern und 15 namibischen Erzierher_innen in Ost-Berlin an und wird im Schloss Bellin in der Nähe von Güstrow (im heutigen Mecklenburg-Vorpommern) untergebracht. Namibische und deutsche Erzieher_innen sind für die Edukation zuständig. In der Schule werden sie getrennt von ostdeutschen Kindern nach einem abgeänderten Lehrplan unterrichtet.
Da später noch mehr Kinder aus Namibia nach Bellin geholt werden (es sind insgesamt 430 namibische Kinder, die in der DDR gelebt haben), reicht im Schloss der Platz nicht mehr aus. Die Ältesten ziehen 1985 nach Staßfurt (im heutigen Sachsen-Anhalt) in die Schule der Freundschaft
um. Hier leben sie gemeinsam mit 900 Jugendlichen aus Mosambik.
Kontakt zu ihrer Familie hat Lucia in der Zeit kaum. Ihre neue Heimat
ist die DDR. Spracherwerb, Schulbildung und DDR-Sozialisation, jedoch wenig Kontakt zu den Menschen der Dominanzgesellschaft4Notiz:
Der Begriff der Dominanzgesellschaft
geht auf den Begriff der Dominanzkultur
von Birgit Rommelspacher (1995) zurück. In dem Begriff kommt zum Ausdruck, dass unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretation sowie Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind
(Rommelspacher 1995, S. 22, orthographische Anpassungen an die neue Rechtschreibung durch D.G.). Ebenso die Gesellschaft ist von diesen Mechanismen geprägt., den DDR-Bürger_innen, werden praktiziert. Im November 1989 fällt die Berliner Mauer. Auf den Tag genau finden freie und demokratische Wahlen zur namibischen Unabhängigkeit statt. Der Krieg in Namibia ist vorbei, die DDR existiert nicht mehr. 1990 werden die nun Jugendlichen nach 11 Jahren in der DDR nach Windhoek (die Hauptstadt Namibias) zurückgeflogen, Repatriierung
(Kenna, 1999, S. 39 f.) nannte sich diese Mission. Dieses gravierende Ereignis stellt einen massiven Bruch in den Leben der jungen Leute dar. Für sie ist Namibia ein fremdes Land, ihre Angehörigen, auf die sie da meist wieder treffen (sofern sie nicht Waisen sind), sind ihnen Fremde. Oft scheitern die Versuche, die Jugendlichen in die leiblichen Familien wieder einzugliedern. Weiße deutsch-koloniale Pflegefamilien übernehmen Patenschaften. Auch Engombe, nachdem es ihr nicht möglich war, mit ihrer Mutter Familienbande zu knüpfen, kommt in einer solchen Pflegefamilie unter. Nach einigen problematischen Momenten in der Schullaufbahn legt sie 1994 das Abitur ab.
Im Anschluss an eine abgebrochene Ausbildung als Werbekauffrau in Deutschland (1996-1997),5Notiz:
Kathrin Schrader: Begegnung mit einem namibischen DDR-Kind, http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0226/magazin/0003/index.html Zugriff: 20.12.2010
fängt sie ein Studium in Journalistik an und arbeitet heute bei einem Radiosender, ebenfalls in Windhoek.
