Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
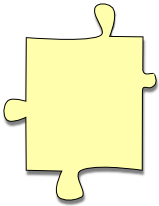
Aukongo und Engombe erleben viele verschiedene Rassismen, deren Ausprägungsformen, Vermittlungsformen, Erfahrungsmodi und Kontexte variieren. Sowohl Engombe als auch Aukongo haben ein Bewusstsein darüber, was Rassismus für sie ist. Sie verstehen darunter meist die massive Ausprägungsform des Rassismus. Gefühlt erleben sie die Wendezeit und die Postwende in Hinblick auf Rassismus als bedrohlicher,1
Notiz:
Auch zurück in Namibia erlebt Engombe nach der Wende an den Schulen Windhoeks Rassismus. Durch die Kolonialzeit leben auch Weiße in der Stadt — in meist wohlhabenderen Gegenden. An den Schulen – und nicht nur da — praktizieren sie Rassismus in massiver und subtiler Form. Engombe 2004, S.341
da hier nun Massivität und Explizität zunehmen.
Rassismus vor der Wende zu DDR-Zeiten war ebenso präsent. Er wurde meist nur nicht benannt, fand im Verborgenen statt und wurde — nicht nur in der Öffentlichkeit — de-thematisiert. Aukongo und Engombe entwickeln unterschiedliche Bewältigungsstrategien, um mit den Erfahrungen umzugehen. Sei es, dass sie kontern und sich wehren (in beiden Fällen, Engombe 2004, S.262 f., Aukongo 2009, S.13), sei es, dass sie mit Traurigkeit, dem Gefühl, Außenseiterin (Aukongo 2009, S.177) und Andersartige zu sein, den Eindruck, eine Sonderbehandlung zu erfahren (Aukongo 2009, S.13, S.93), oder mit Angst und verunsicherten Zugehörigkeitsgefühlen reagieren (Aukongo 2009, S.158).
Rassismus ist existent und wirkmächtig — sowohl in der DDR als auch heutzutage. Dies wollte ich mit meiner Analyse aufdecken. Der Text sollte einen Einblick in und eine Analyseperspektive auf ein Forschungsgebiet (Migration in die DDR) geben, das noch relativ unberührt ist, mit dessen Beschäftigung viele Erkenntnisse über gesellschaftliche Strukturen — nicht nur über die der DDR — gewonnen werden können.
Perspektiven von Minorisierten2 Notiz:
in Betonung der Prozesshaftigkeit der Minorisierung
(nach Gabriele Rosenstreich 2006, S.196), die ihre Geschichte erleben, habe ich fokussiert, ohne dabei die politisch-historischen Ereignisse auf der Makroebene zu vernachlässigen. Aukongo und Engombe schreiben mit ihren Autobiographien Geschichte von unten
.
Die Beschäftigung mit dem Thema hat mich mit meinen Emotionalitäten konfrontiert. Die Autobiographien haben mich tief berührt, und es war nicht immer möglich, sachlich und analytisch zu bleiben, vor allem wenn Ungerechtigkeiten und Brutalitäten so deutlich zu Trage treten. Mir ist sehr bewusst geworden, dass ich bestimmte Erfahrungen, z.B. Gewalterfahrungen auf Grund meiner physiognomischen Merkmale (weiß zu sein) nicht gemacht habe und auch nicht machen werde (im Vergleich z.B. zu Aukongo, die im Bus von einer Männergruppe massiv angegriffen wird). Die damit verbundenen Privilegien sind mir im Vergleich deutlich geworden (so ist mir durchaus möglich, ohne Angst mit den öffentlichen Verkehrmitteln durch Ost-Berlin zu fahren. Aukongo ist dies nicht möglich).
Die Frauen schildern aber nicht nur unangenehme Ereignisse und Widerstände, sondern man kann auch teilhaben an schönen und glücklichen Momenten. In den Darstellungen sind die jungen Frauen (Mädchen) einfach sie selbst, und deshalb habe ich sie nicht nur als Gegenstand meiner wissenschaftlichen Analyse angesehen, sondern auch als emotionale Bereicherung und Lernfläche empfunden.
