Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
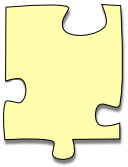
Aukongo kehrt als Kleinkind nach langen Kämpfen der Pflegefamilie aus dem Krieg nach Ost-Berlin zurück. Als sie eingeschult wird, verordnet das Volksbildungsministerium, dass Aukongo spätestens zu diesem Zeitpunkt mit afrikanischen Menschen aufwachsen
soll (Aukongo 2009, S. 80). Das bedeutet, dass sie bei den namibischen Kindern in dem Heim im Schloss Bellin integriert
werden soll, dort, wo auch Engombe lebt.
An dieser Stelle berühren sich die Lebensläufe der beiden Frauen fast. Die staatliche Anordnung greift in das Leben von Aukongo ein und sieht vor, dass sie ihre gewohnte Umgebung, ihre Pflegefamilie, verlassen soll. Dies nenne ich schicksalhaftes Einmischen in ihren Lebensweg. Es handelt sich bei dieser Verordnung um einen institutionellen Rassismus, der mit der Macht der Durchsetzung, der Reglementierung und dem Wirkmächtigwerden von Unterscheidungspraxen verbunden ist (Mecheril/Melter 2010, S. 156). Zu dem werden auch hier Ortzuweisungen vorgenommen.
Hinter dem mit afrikanischen Menschen aufwachsen
steckt aber noch eine andere Idee und Imagination: Aukongo soll kollektiviert werden, sie soll mit den Menschen leben, die ihr zugehörig
sind. Diese Menschen werden kollektiv genannt (afrikanisch
, nicht etwa namibisch), es wird eine kollektive Einheit
imaginiert. Aukongo soll ihr Afrikanischsein
bewahren. Durch das Zusammenleben mit anderen Afrikanern
könnte dies bewerkstelligt werden. Dass die namibischen Kinder wenig mit der kulturalisierten Vorstellung von afrikanischen
Menschen und deren Lebensweisen gemeinsam hatten, zeigte sich daran, dass sie deutsch sprachen, auf deutsch dachten und DDR-sozialisiert waren. Die Vorstellung des gemeinsamen Zusammenseins mit afrikanischen
Menschen stellt eine subtile Form von Rassismus dar: eine Idee von kollektivem und kulturalisiertem Wesen und seiner Einheit
, wo statische Zugehörigkeiten zugewiesen werden (Mecheril/Melter 2010, S. 156).
Unter afrikanischen Menschen leben
: diese Idee hat auch das Potential, positive Identifikationsprozesse mit dem Namibischsein
zu unterstützen. Positive Zugehörigkeitsgefühle in der Gruppe, unter Seinesgleichen
sein und sich selbst als zugehörig dieser Gruppe zu bezeichnen (Mecheril 1997b, S. 297, zitiert nach Paske 2006, S. 20), dies könnte ebenso eine Konsequenz der Verordnung und der dahinter liegenden Idee sein. Ob dieser Prozess sich automatisch bei den namibischen Kindern eingestellt hat oder sich bei Aukongo einstellen würde, sei dahin gestellt.
Dass es sich jedoch um eine Verordnung handelt, zeigt, dass Zwang dahinter liegt und dies nicht im Sinne von ungezwungenem, freiwilligem Zusammenleben mit namibischen Menschen und den daraus eventuell resultierenden positiven Zugehörigkeitsgefühlen zu verstehen ist.
Aukongo bleibt bei ihrer Familie. Auf Grund ihrer Behinderungen ist sie nicht tauglich für die Elite
der SWAPO. Es ist auffällig, dass von den insgesamt 430 namibischen Kindern kein einziges behindert ist, wird in der Autobiographie bemerkt. Im Krieg, besonders im Massaker von Cassinga hat es jedoch viele verstümmelte Kinder gegeben (Aukongo 2009, S. 81). Hier zeigt sich eine spezifische Selektion, wer als tauglich eingestuft worden ist und wer nicht. Man kann von Auslese in Hinsicht auf Ableism
sprechen. Diskriminierung auf Grund von körperlicher Behinderung — im Ausleseprozess im Bürgerkrieg, aber auch dadurch, dass Aukongo nicht als gesund genug eingestuft wird für die Elite
Namibias- wird praktiziert.
