Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
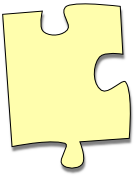
(Für alle Informationen dieses Abschnitts wurde die gesamte Autobiographie von Aukongo (2009) herangezogen.)
Der Krieg gegen Südafrika berührt auch das Schicksal von Aukongo. Im Mai 1978 überfallen südafrikanische Truppen das Flüchtlingslager Cassinga, das ca. 250 Kilometer nördlich der namibisch-angolanischen Grenze in Angola liegt. Rund 600 namibische Menschen, die in dem Lager untergekommen sind, vor allem Frauen und Kinder sterben, viele werden verletzt, darunter auch Aukongos Mutter, die angeschossen wird. Der Angriff wird international verurteilt. Die DDR nimmt im Juni 1978 zwanzig Verletzte im Rahmen einer Solidaritäts-Pflege-Aktion
auf, die im Klinikum Buch in Ost-Berlin behandelt werden. Ihre Mutter ist unter ihnen. Im September kommt Aukongo unter vielen Komplikationen zur Welt. Aukongo ist bereits im Mutterleib verletzt worden und lebt mit einigen Behinderungen.2
Notiz:
Dazu zählen eine spastische zerebrale Hemiparese, eine halbseitige, leichte Lähmung, die vom Gehirn ausgeht und zu Verkrampfungen der Muskulatur führen kann, ähnlich einer Epilepsie. Zudem spekulierte der damalig behandelnde Arzt, dass die Hemiparese sich eventuell auch negativ auf die geistige Entwicklung ausüben könnte. Aukongo bemerkt, dass sie zu Einschulungszeiten etwas langsam
war (in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit). Aukongo 2009, S. 82. Weitere Behinderungen sind die Taubheit auf einem Ohr, die Fehlstellung des einen Auges und hinkender Gang.
Eine Berliner Pflegefamilie nimmt sich ihrer an und pflegt sie liebevoll, Aukongos eigene Mutter jedoch geht von Anfang an auf Distanz zu ihr. Nach einem Jahr endet die Solidaritätsaktion und die Mutter wird mit ihrer Tochter zurück in den Krieg geflogen. Die Pflegefamilie kämpft um die Rückkehr des kleinen Mädchens. Durch viele Zufälle, Hartnäckigkeit, Ausdauer und Glück kann Aukongo nach Berlin Prenzlauer Berg zu ihren neuen Eltern
zurückkehren.
Sie wächst in der DDR auf, wobei die Aufenthaltsdauer unbestimmt bleibt: eine weitere Abschiebung könnte jederzeit möglich sein. Mit dieser Angst im Hintergrund lebt Aukongo Zeit ihrer Jugend. Nach der Wende erhält sie 1995 endlich die deutsche Staatsbürger_innenschaft. Nach dem Beenden der Realschule absolviert sie eine Ausbildung als Bürokauffrau im geschützten Rahmen einer Behindertenstiftung, studiert dann an einer Abendschule BWL und schließt im Folgenden ein Studium in Public Management an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht ab.
Nach der Wende besucht sie ihre leibliche Mutter mehrmals in Namibia - in Windhoek und im Ovamboland (einer ländlichen Gegend). In Windhoek ist sie auch Praktikantin der Organisation Women's Action for Development
, wo sie auf die fatale Lage der namibischen Frauen konfrontiert wird, die als Sexarbeiterinnen arbeiten müssen3
Notiz:
da die namibischen Frauen aus einer ländlichen Gegend, dem Ovamboland kommen, über wenig oder keine Bildung verfügen, in der Stadt keine Arbeit finden und (viele) Kinder haben, die sie ernähren müssen (Aukongo 2009, S. 201).
und dabei die Infizierung mit HIV in Kauf nehmen.4
Notiz:
AIDS wird in Namibia stark tabuisiert. Die Quote der infizierten und bereits erkrankten 15-49jährigen Namibier_innen ist eine der höchsten der Welt: 15,3% (Deutschland: 0,1%). Aukongo 2009, S. 200f.
