Rassismus und die DDR?! Repräsentationen von Rassismuserfahrungen namibischer Mädchen vor, während und nach der Wende.
Eine Analyse der Autobiographien von Stefanie-Lahya Aukongo und Lucia Engombe.
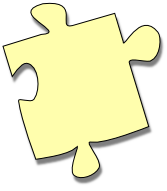
Anhand von Beispielen will ich zeigen, dass die Darstellungen der Gedanken der Modelle Aukongo
und Engombe
in den Autobiographien nicht unproblematisch sind und m.E. rassistische Reproduktionen beinhalten. Hiermit will ich zu dem eigentlichen Forschungsgegenstand, die Auseinandersetzung mit dem Rassismus, überleiten.
Beispiel 1: (Aukongo soll ihre leibliche Mutter in Namibia besuchen, was sie nicht will):
'Du musst da durch, Steffi! In Namibia sind deine Wurzeln', mahnte mich meine Oma. Leute in Baströckchen - wo sollten da meine Wurzeln sein?
(Aukongo 2009, S. 124)
In diesem Beispiel werden Zuschreibungen zu Zugehörigkeiten und mögliche rassistische Reproduktionen durch den Autor
Peter Hilliges, der die Autobiographie von Aukongo (und auch von Engombe) aufgezeichnet und verschriftlicht hat, deutlich. Wie diese Aussagen letztendlich zu Stande kamen, ist unklar, ob es sich um eine Verinnerlichung von rassistischen Zuschreibungen und deren subversive und ironische Aneignung oder um das Bedienen von rassistischen Stereotypen durch den Ghostwriter
Peter Hilliges handelt.1
Notiz:
Esoterische Afrika-Romane sind das eigentliche Metier des Autors
(Quelle: Kathrin Schrader: Begegnung mit einem namibischen DDR-Kind, http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0226/magazin/0003/index.html, Zugriff: 20.12.2010).
Mit den Zeitzeuginnenberichten über die DDR bewegt er sich auf einem thematisch für ihn neuen Gebiet. Ob die Frauen ihm Interviews gegeben haben, die er dann modifiziert und mit eigenem Dazudichten
nieder geschrieben hat, ob die Frauen auch Passagen selber geschrieben haben, wie die Übertragung vom Mündlichen ins Schriftliche geschah (wortgetreu oder mit eigenen Formulierungen), dies bleibt unklar und offen. Gerade weil in esoterischen Afrika-Romanen mit rassistischen Stereotypen gearbeitet wird, unterstelle ich Hilliges eine ähnliche Vorgehensweise in den Autobiographien von Aukongo und Engombe.
Aukongo grenzt sich davon ab, dass sie in Namibia ihre Wurzeln hätte, ihre Oma platziert sie durch territoriale Zuschreibungen an diesen Ort und deplatziert sie damit aus dem deutschen Kontext (Mecheril/Melter 2010, S. 153). Die Oma weist ihr Zugehörigkeiten zu (sogar mit mahnendem Unterton). Auf Grund ihrer natio-ethno-kulturellen Herkunft sei Aukongo verpflichtet, sich mit Namibia auseinander zu setzen (z.B. durch eine Reise). Die Oma macht durch Zugehörigkeitszuweisungen territoriale (De-)Platzierungen. Aukongo verneint mit ihrer Bemerkung diese Zugehörigkeitszuweisung. Für sie ist Namibia (noch)2
Notiz:
Später wird Namibia in ihrer Entwicklung von Mehrfach-Zugehörigkeitsgefühlen immer wichtiger. So äußert sie: Ich gelangte schließlich zu dem Fazit: Mir würde weder die eine noch die andere Welt genügen; ich brauchte beide.
Aukongo 2009, S: 230. Oder (beim Besuch der leiblichen Oma im Ovamboland): Ich fühlte mich jetzt als Owambomädchen. Ich gehörte einem Stamm an. Das empfand ich als etwas unglaublich Spannendes.
Aukongo 209, S: 176. In meinem Inneren war ich tief gespalten, wohin ich gehörte...In mein Tagebuch schrieb ich: ,Ich bin weder deutsch noch namibisch. Ich bin so hin und her gerissen. Zu den Leuten hier gehöre ich nicht, und nach Afrika ebenso wenig.’
Aukongo 2009, S. 158 f. Und: Ich war außen schwarz und innen weiß.” Aukongo 2009, S. 166. Diese Beispiele, aus denen sich wertvolle Erkenntnisse über Aukongos Zugehörigkeitsgefühle gewinnen lassen, erwähne ich hier leider nur am Rande. Zu dem Begriff der Zugehörigkeit ausführlicher: Mecheril 2003, Kapitel IV.
kein Ort, der ihre Zugehörigkeitsgefühle weckt.
Allerdings ist das Mahnen der Oma, die eigenen Wurzeln nicht zu ignorieren, nicht nur negativ zu sehen. Die Auseinandersetzung mit Zugehörigkeiten und deren Ambivalenzen wird durch die Aussage der Oma angeregt. Dieser Aspekt beinhaltet nicht nur Rassismen, sondern dient der Reflexion über Identifikationsfindung und der Entwicklung von (Mehrfach)Zugehörigkeitsgefühlen. Die Oma will vielleicht damit sagen, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Namibia das Zuhause von Aukongo ist.
Beispiel 2: (Engombe kommt in Schloss Bellin an. Es wird die Situation der Eingewöhnung geschildert. Engombe 2004, S. 46) Oder das Zähneputzen: ,Hm, schmeckt lecker, so süß!’, meinten einige Kinder. ,Probier mal.’ Tatsächlich, dachte ich und futterte begeistert Zahnpasta. Aus Nyango [das Lager in Sambia, Anmerkung D.G.] kannte ich schließlich nur meinen schwarzen Zahnstrauch und musste nun lernen, etwas in den Mund zu nehmen, das ich dennoch nicht essen durfte...Nicht mal vor den Kristallen im Klobecken wurde Halt gemacht! Die sahen aber auch zu lecker aus und glitzerten so verlockend...
Auch hier vermute ich rassistische Stereotypenbedienung durch Hilliges. Bilder unzivilisierter (Kilomba 2008, S. 44) namibischer Kindern in Beispiel 2 werden gezeichnet und damit Rassismen vermittelt. Die Kinder wissen nicht, wie man mit Zahnpasta umgeht und dass man Kristalle in Toilettenbecken nicht in den Mund nimmt. Mentalitäten
mit unwissenden Charaktären
und naiven Eigenschaften
der namibischen Kinder werden durch fragwürdige Darstellungen entworfen und damit ein Rassismus indirekt und subtil reproduziert (Mecheril/Melter 2010, S. 156).
Mit diesen Repräsentationen von (angeblichen) Aussagen von Aukongo und Engombe durch Hilliges möchte ich auf die nicht unproblematische Nachzeichnung von vermeintlich selbstverständlichen Bildern von Afrika
und den dort lebenden Menschen aufzeigen. Subversive Aneignungsprozesse der jungen Frauen wären möglich, aber das Bedienen von Stereotypen durch Hilliges und seiner Modelle halte ich für wahrscheinlicher. Durch die Hinterfragung dieser Repräsentationen verstricke ich mich ebenso in rassistische, zu strikte Denkmuster. Die Problematik in der Darstellung Hilliges wollte ich jedoch nicht unbenannt lassen.
