Gräben und Brücken
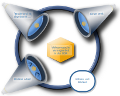
Tabelle zu Gräben und Brücken
Gräben und Brücken
Die grundlegende Idee dieser Arbeit entstand mit folgender Fragestellung:
Ausgehend von der Gründungszeit der beiden deutschen Staaten stellt die DDR für mich den deutlich mutigeren und vorwärtsgewandteren Versuch einer Gesellschaftskonzeption dar. Wie kann es aber in einer Gesellschaft, die sich der internationalen Solidarität und Freundschaft verpflichtet versteht, möglich sein, dass Erfahrungen wie in der Publikation Bruderland ist abgebrannt
beschrieben, gemacht werden? Ist die Ideologie trotz allem Beteuerns selbst eine rassistische? Ist das Handeln der DDR als Staat nicht von der eigenen Ideologie gedeckt?
Im Prozess der Auseinandersetzung und des Schreibens musste ich feststellen, dass diese Fragestellung keine einfache ist, da sie versucht Themenbereiche zusammen zu führen, die in nicht unerheblicher Spannung zu einander stehen. Diese Spannung versuche ich mit der Metapher von Gräben und Brücken zum Ausdruck zu bringen. Dabei muss gar nicht jeder Graben gleich tief sein oder jede Brücke gleich stabil. Dennoch erfüllen sie ihren Zweck des Trennens und des Zusammenführens. Zwei der großen Gräben der Arbeit, die Frage von unterschiedlichen Ebenen und die der Zeit habe ich eigens bearbeitet. Eine Übersicht über weitere findet sich in der tabellarischen Übersicht.
Im Schreiben veränderte sich meine Arbeit. Es geht ihr nun gar nicht mehr um eine Vereinbarkeit. Um ein Zusammenbringen der beiden Punkte. Vielmehr geht es darum, dass es verschiedenen Perspektiven auf das gleiche Thema sind. Wobei fraglich ist, ob das Thema als gleich beschrieben werden kann. Es geht nun um die Koexistenz von Perspektiven als analytisches Ergebnis, dies hat den Vorteil, dass ich meine eigene Perspektive gleich von Beginn an transparent in die Arbeit einfließen lassen kann. Diese Option aus einem dreifachen Zugang mich einem Thema zu nähern finde ich reizvoll und ergiebig.
Verschieden Ebenen
Ursprünglich war es mein Plan wie in der Mengenlehre üblich die Schnittmenge zu bilden von Ideologieproduktion und Erfahrungsberichten und mir die Restmengen zu betrachten. Anders als in der Mengenlehre vorausgesetzt habe ich mir vorgenommen zwei Dinge miteinander in Berührung zu bringen, die in mehreren Bereichen auf verschiedenen Ebenen liegen. Ich möchte an dieser Stelle einige Argumente für die praktische Umsetzbarkeit setzen.
Zentrales Moment ist die Spannung zwischen Ideologie und Erfahrung. Sie entsteht, da Ideologie etwas ist, dass in Büchern steht, verhandelt wird, diskutiert wird, die Auseinandersetzungen dokumentiert werden, beständige Anpassungsleistung an die Lebenswirklichkeiten geleistet werden müssen. Es gibt einen Kanon, Anerkennung und Ablehnung. Die Erfahrungen einzelner sind different. Von Person zu Person verschieden. Inkongruent innerhalb von Personen. Zeitabhängig, ortsverschieden und stimmungslabil.
Und dennoch kann eine einzelne situative Erfahrung eines Menschen zusammen gebracht werden mit dem System von Ideologie. Noch mehr ist möglich: die Erfahrung eines einzelnen Menschen kann das wunderbarste Ideologiegebäude zum Einsturz bringen. Ein Einsturz, der erzeugt wird durch eine Inkongruenz zwischen der Ideologie und der alltäglichen Einzel-Erfahrung. E ∉ I. Entgegen der ideologische Prämisse: E &in I.
Meine Arbeit ermächtigt und benutzt damit einzelne, und in der BRD strukturell marginalisierte Personen, die Leistungsfähigkeit und innere Deckung der DDR Ideologieproduktion zu messen. Sie verschiebt gesellschaftliche Machtbefugnisse an der einen Stelle und etabliert sie an anderer Stelle, an der ich diese Arbeit verfasse zugleich wieder. Neben einem Erkenntnisgewinn im epistemologischen Sinne ist diese erste Verschiebung zu gleich ein argumentativ wirkungsvolles Moment politischer Lust.
Was vielleicht schon aufgefallen ist oder erst bei der weiteren Lektüre klar wird, ist die Tatsache, dass dieses Übereinanderlegen nicht in Textform auffindbar ist. Es ist etwas, dass durch die Laufbänder beim Lesen der jeweiligen Stränge bei der_m Leser_in passiert. Passieren kann.
Zeitgraben
Ein weiterer Gap tut sich auf. Einer der sich für Historiker_innen als nahezu unerträglich gestaltet. Ein Zeitsprung zwischen dem Zeitraum der Jungen Welt Analyse und dem Zeitraum der Erfahrungen. Wenn ich retrospektiv den Zeitraum von etwas über einem Jahr als einen Moment erscheinen lasse, dem selbst keine Dynamik innewohnen würde, so wird der Gap zu den zehn Jahren aus denen ich Erfahrungen sammele deutlich. Ich höre die Stimmen aus dem Graben: Anachronismus!
Historisch nicht vertretbar!
Kardinalsfehler!
Wie recht sie haben.
Ein präzises Vorgehen würde den Analysebereich der Jungen Welt zeitlich in Deckung bringen mit dem Bereich der Erfahrungen. Ein solches Vorgehen würde mich für eineinhalb Monate in die Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek verbannen, würde vermutlich über 1000 Artikel zum Thema DDR - Vietnam ausfindig machen, wäre durch mich nicht bewältigbar.
Ich könnte die Erfahrungen an anderem Ort suchen als bei Reistrommel e.V. Ich könnte versuchen näher an den Beginn der Vertragsarbeit und den dort gemachten Erfahrungen heranzukommen. Aber ist das wirklich notwendig? Mein Ziel ist es Ideologie und Erfahrung in Kontext zu setzen, um zu betrachten, was dabei passiert.
Zu Beginn 1980 wurde der Vertrag zwischen beiden Staaten ausgehandelt, der die Grundsätze der Vertragsarbeit reguliert. In diesem Zeitraum positioniert sich die Junge Welt zu Vietnam. Im Geiste dieser Zeit wurden der Vertrag abgeschlossen. Die Position der Jungen Welt ist keine statische, sie verändert sich, passt sich an, adaptiert sich an die Wirklichkeit und ist damit veränderlich. Diese Dynamik erfasst meine Arbeit nicht. Das Stimmungsbild, dass sich 1980 bietet setzt sie dann in den Kontext von Erfahrungen über einen Zeitraum von 10 Jahren. In einer gewissen Form ist sie damit chronologisch. Sie fragt was passiert auf Basis der 1980 gefassten Positionen.
Sie fragt, obwohl es verlockend ist, nicht: Wie wandelt sich die Berichterstattung der Jungen Welt? Sie fragt nicht: Passt die Junge Welt die publizierte Ideologie an Notwendigkeiten an? Während meine Arbeitskapazität eine Grenze der Arbeit darstellt, stoßen die letzten beiden Fragen an die konzeptionelle Grenze meiner Arbeit. Es geht mir nicht um Mediengeschichte, ja nicht einmal die geliebte Diskursanalyse ist die zentrale Methode meiner Arbeit. Es geht mir darum über die DDR zu lernen. Meine Positionen der Nähe und Distanz zu ihr erfahren zu können. Eine überdachte Position abseits der Binarität von DDR-Bashing — Ostalgie zu finden.
Aus diesen Gründen heraus erlaube ich mir den Ansatz meiner Arbeit trotz der berechtigten Kritiken daran bestehen zu lassen und als umsetzbar zu verstehen.
